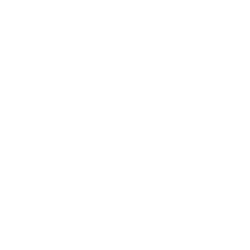Wenn es eine Konstante in der juristischen Ausbildung gibt, so ist es der Ruf nach Reform. Wurde in den 1970er-Jahren über die einstufige Ausbildung diskutiert, rang man in den 1980er-Jahren um deren Abschaffung. In den 1990er-Jahren stand der Freischuss zur Debatte, in den 2000er-Jahren folgte die Auseinandersetzung über das Schwerpunktstudium und den Bologna-Prozess. Inzwischen ist der Wunsch nach grundlegenden Veränderungen verblichen. Nur vereinzelt ertönt der Ruf nach Abschaffung des Schwerpunkts.1 Es geht eher um Vereinheitlichung und Vereinfachung. Zumindest die Justizminister sind sich darüber einig, dass der Prüfungsstoff begrenzt und „harmonisiert“ werden müsse.2 Zwar wollen sie aufgrund des Föderalismus „eine gewisse Bandbreite“ unterschiedlicher Regelungen hinnehmen.3 In ihren Vorschlägen aber ist von einer föderalen Freiheit wenig zu spüren. Die Vorgaben sind denkbar detailliert und enthalten etwa einen paragraphengenauen Pflichtfachkatalog.4 Auch der Deutsche Juristen-Fakultätentag befürwortet im Grundsatz eine Angleichung.5
Während man sich damit über eine Vereinheitlichung weitgehend einig ist, besteht tiefgreifende Uneinigkeit darüber, wie sie aussehen soll. Das betrifft nicht nur die Gewichtung des Schwerpunkts mit 20 % oder 30 % der Examensnote, sondern auch die Möglichkeit eines Abschichtens von Prüfungsleistungen und die Gestaltung des der Prüfung zugrundeliegenden Stoffkatalogs. Schaut man sich das geltende Recht an, so findet sich dazu allerdings bereits eine aussagekräftige einheitliche Vorgabe. § 5a Abs. 2 S. 3 DRiG bestimmt als Pflichtfächer „die Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des Strafrechts, des Öffentlichen Rechts und des Verfahrensrechts einschließlich der europarechtlichen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen.“ Indes besteht offenbar der Eindruck, dass die bundesweite Prüfungspraxis zu uneinheitlich wäre, als dass man sich mit dieser Vorgabe begnügen könnte.
Nun weichen die einzelnen Landesprüfungsgesetze in der Tat stellenweise voneinander ab und definieren in Teilbereichen den Stoff unterschiedlich. Ist das aber ein großes Problem? Die Absolventen wechseln das Bundesland zum Referendariat recht rege. Zum Teil haben bis zu 54 % der eingestellten Referendare die erste Prüfung in einem anderen Bundesland abgelegt.6 Wäre der erlernte Stoff sehr unterschiedlich und damit eine gravierende Umstellung vonnöten, wäre das kaum zu erwarten. Auch der Austausch von Klausuren über den Ring funktioniert gut, ohne dass erhebliche Anpassungen7 erforderlich wären. Bis auf Bayern nehmen alle Bundesländer an diesem Austausch teil.8 Dieser wäre ausgeschlossen, wenn die Ausbildung und die gesetzlichen Anforderungen zu uneinheitlich wären. Woher aber kommt dann der so starke Wunsch nach Vereinheitlichung?
Es liegt nahe, dass die beklagte Uneinheitlichkeit weniger unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen betrifft, sondern eher die Prüfungspraxis. Die bundesweiten Vorgaben des DRiG sind in der Tat so abstrakt, dass die Länder sie sehr unterschiedlich konkretisieren und handhaben könnten. Die Frage allerdings ist: Geschieht das tatsächlich? Weichen die Klausuren und die Korrekturen so erheblich voneinander ab, dass die Examina bundesweit kaum vergleichbar wären? Das sind empirische Fragen, die sich nicht durch einen Blick in das Gesetz oder durch anekdotische Eindrücke von der eigenen Universität und der eigenen Ausbildung lösen lassen. Umso interessanter ist es zu sehen, auf welche empirische Grundlage die Justizminister ihre Reformvorschläge stützen.
Die Notwendigkeit einer statistischen Untersuchung streifen sie nur am Rand, etwa wenn sie darauf verweisen, „aus technischen Gründen“ habe keine „verlässliche Statistik“ zur Frage erstellt werden können, ob die Schwerpunktausbildung zu einer Vernachlässigung des Pflichtstoffs geführt hätte.9 Man hätte dafür allerdings nur eine Umfrage durchführen müssen, wie viel Zeit die Studenten auf den Schwerpunkt verwenden und wie viel Zeit ihnen noch für die Klausurvorbereitung bleibt. Ein Unbehagen gegenüber Statistiken klingt auch bei der Behandlung der Frage an, ob man die Prüfung zur Notenverbesserung wiederholen darf. Dazu weist der Koordinierungsausschuss auf tatsächlich auftretende Fälle einer Verbesserung hin und betont, dass die Verbesserungsmöglichkeit „unabhängig von abstrakten Statistiken“ einen Vorteil biete.10
Nun haben mit konkreten Fällen befasste Juristen häufig wenig Neigung zu „abstrakten Statistiken“. Allerdings wären die hier womöglich hilfreich. Denn würde sich etwa herausstellen, dass nur ein Bruchteil derjenigen, die einen Verbesserungsversuch unternehmen, sich merklich verbessert, dann dürfte zumindest aus dieser Möglichkeit keine erhebliche Uneinheitlichkeit erwachsen. Denn die Bundesländer, die eine derartige Verbesserung ermöglichen, würden ihren Absolventen damit keinen nennenswerten Startvorteil geben. Dies gilt umso mehr, als die Wiederholung erhebliche Zeit kostet und sich im Lebenslauf bemerkbar macht. Von der Zahl derjenigen, die sich in einem zweiten Versuch verbessern, müsste man überdies die Zahl derjenigen abziehen, die zunächst keinen ernsthaften Prüfungsversuch unternehmen, sondern damit nur einer Aufforderung des BAföG-Amtes nachkommen. Empirisch untersucht ist all das bisher nicht und der Verweis auf „tatsächlich auftretende Fälle“ keine solide Grundlage für eine Gesetzesreform.
Gibt es aber sonst Evidenzen für eine bundesweite Uneinheitlichkeit der Staatsprüfungen? Um dies herauszufinden, haben Uwe Engel, Franziska Ritter und der Autor dieser Zeilen juristische Staatsprüfungen der Jahre 2009–2014 bundesweit ausgewertet, sofern die Länder bereit und in der Lage waren, diese Daten zur Verfügung zu stellen.11 Ausgangspunkt war die Feststellung, dass es zwischen der ersten und der zweiten Staatsprüfung einen signifikanten statistischen Zusammenhang gibt.12 Diejenigen, welche die erste Prüfung mit guter Punktzahl ablegen, sind meist auch im zweiten Examen erfolgreich. Umgekehrt schneiden diejenigen, welche die erste Prüfung nur schlecht bestehen, auch in der zweiten Prüfung selten mit großem Erfolg ab. Dieser Zusammenhang lässt sich nutzen, um die Anforderungen der einzelnen Bundesländer miteinander zu vergleichen. Denn dadurch ist das Abschneiden derjenigen, die das Bundesland wechseln, ein Indikator, ob die erste Prüfung unterschiedlich schwer war.
Im Einzelnen wurde dazu eine Regressionsanalyse durchgeführt, die feststellen sollte, inwieweit die Herkunft aus einem einzelnen Bundesland in der ersten Prüfung mit einem bestimmten Abschneiden in der zweiten Prüfung korreliert. Da die Wechsler nicht unbedingt repräsentativ für alle Absolventen sind, wurden die Ergebnisse dabei in einem weiteren Schritt auf die Note in der ersten Prüfung kontrolliert. Berücksichtigt wurde auch, dass die Notenverteilung zwischen der ersten und der zweiten Prüfung unterschiedlich ausfällt und es auch dabei regionale Differenzen geben kann. Eine vergleichsweise milde Beurteilungspraxis, wie sie den Stadtstaaten Bremen und Hamburg in der ersten Prüfung nachgesagt wird, muss nicht mit einer entsprechend milden Beurteilungspraxis in der zweiten Prüfung einhergehen.
Im Ergebnis ließen sich zum Teil beträchtliche Unterschiede feststellen, bewegten sich aber in der Mehrzahl der Fälle unter einem Punkt.13 Am krassesten war der Unterschied im Wechsel von Nordrhein-Westfalen nach Bremen, bei dem es zu einem Wechseleffekt von 1,6 Punkten kam. Dies bedeutet, dass die nordrhein-westfälischen Absolventen der ersten Prüfung im Vergleich zu den Bremer Absolventen mit derselben Ausgangsnote eine um 1,6 Punkte höhere Note in der zweiten Prüfung zu erwarten hatten. Umgekehrt ließ sich auch ein negativer Wechseleffekt derjenigen feststellen, die von Bremen nach Nordrhein-Westfalen wechseln. Sie haben eine um 0,6 Punkte geringere Note als diejenigen zu erwarten, die bereits in Nordrhein-Westfalen die erste Prüfung abgelegt haben.
Diese Unterschiede dürften indes kaum auf unterschiedliche Prüfungsanforderungen zurückgehen. Im Gegenteil: Während in Nordrhein-Westfalen ein Abschichten möglich ist, d.h. die Absolvierung der Klausuren zu unterschiedlichen Terminen,14 ist das in Bremen15 ausgeschlossen. Die Wettbewerbsverzerrung, welche die Justizminister zugunsten derjenigen Länder vermuten, welche ein derartiges Abschichten zulassen,16 ist also zumindest im Ergebnis kaum spürbar. Das zeigt sich auch, wenn man die nordrhein-westfälischen Absolventen mit den bayerischen Absolventen vergleicht, denen so wie der Mehrzahl der Examenskandidaten keine Abschichtungsmöglichkeit offensteht. Weder beim Wechsel von Bayern nach Nordrhein-Westfalen noch umgekehrt von Nordrhein-Westfalen nach Bayern ließ sich ein signifikanter Wechseleffekt feststellen.17 Freilich könnte man all das noch genauer untersuchen, indem man etwa die Wechsler gesondert erfasst, welche von der Abschichtungsmöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Ohne eine derartige Studie lässt sich allerdings angesichts der bereits festgestellten Wechseleffekte nicht von einer nennenswerten Wettbewerbsverzerrung ausgehen.
Gleiches gilt für den Fächerkatalog. Der unterscheidet sich zwar in einzelnen Bereichen. Etwa ist in Bayern im Immobiliarsachenrecht weniger ausgeklammert als in Nordrhein-Westfalen.18 Dieses verlangt hingegen anders als Bayern bereits in der ersten Prüfung Kenntnisse im Internationalen Privatrecht.19 Wechseleffekte lassen sich gleichwohl nicht feststellen und sind auch nicht plausibel. Wer es nach neun Semestern beispielsweise geschafft hat, in weiten Teilen des Bürgerlichen Rechts gute Kenntnisse zu erwerben, für den dürfte weder das Hypothekenrecht noch das Internationale Privatrecht eine Hürde sein. Auf beides kann man sich so wie auf andere Fächer vorbereiten und die allgemeinen methodischen Fähigkeiten anwenden. Gleiches gilt für Unterschiede im Landesrecht, die vor allem im Verwaltungsrecht auftreten. Die Befürchtung, dass unterschiedliche Konkretisierungen der von § 5a Abs. 2 S. 3 DRiG vorgegebenen Kernfächer zu einer fehlenden Vergleichbarkeit der einzelnen Prüfungen führen, ist daher zumindest statistisch unplausibel.
Die in § 5d Abs. 1 S. 2 DRiG geforderte Einheitlichkeit der Prüfungsanforderungen dürfte von größerer Relevanz für eine ganz andere Frage sein, nämlich ob die Anforderungen zwischen dem staatlichen und dem universitären Teil einander entsprechen. Denn § 5d DRiG regelt mündliche wie schriftliche Prüfungen und bezieht sich ausdrücklich auch auf den Schwerpunkt. Offenbar ist das Richtergesetz an dieser Stelle von der Sorge getragen, dass andere Prüfungsformate als die Fallklausuren die Qualität und Aussagekraft der Examensnote beeinträchtigen. Schaut man sich die Ergebnisse der Schwerpunktprüfung bundesweit an, so ist diese Sorge nur allzu berechtigt. Während im Jahr 2017 bundesweit im staatlichen Teil 16,8 % ein Prädikat erzielten, war dies im Schwerpunkt bei 59,1 % der Kandidaten der Fall.20 Es bedarf keiner vertieften statistischen Kenntnisse, um die Inflation auf eine fast vierfach höhere Prädikatsquote im Schwerpunkt festzustellen. Das ist umso problematischer, als selbst die Klausurprüfungen an der Universität viel strenger ausfallen. All das stellt daher die Gestaltung der Schwerpunktprüfung in Frage. So dürften die eingeschränkte Anonymität, die Identität von Lehrenden und Prüfenden sowie die Anreize zur Steigerung der Attraktivität des eigenen Schwerpunkts zu einer Verwässerung der Examensergebnisse beitragen.
Wenn man also die Einheitlichkeit der Prüfungsanforderungen sicherstellen will, so sollte man in erster Linie nicht an die föderalen Unterschiede in den Prüfungsbedingungen denken. Vielmehr gilt es, die Kluft zwischen universitärem und staatlichem Teil zu überwinden. Die über Jahrzehnte erprobte Qualität des letzteren spricht dafür, eher die Prüfungsbedingungen für den Schwerpunkt zu ändern als die Korrektur der staatlichen Examensklausuren. Dafür bietet sich eine Vielzahl von Maßnahmen an. Zu denken wäre etwa daran, Lehre und Prüfung personell deutlicher zu entkoppeln. Kann man wie im staatlichen Teil nicht sicher sein, dass der Lehrende einen auch prüft, muss man die allgemeinen Kenntnisse im Schwerpunkt unabhängig davon erwerben, was in den einzelnen Veranstaltungen dazu vermittelt wird. Durch eine derartige Entkoppelung würde auch dem Fehlanreiz der Prüfer vorgebeugt, durch eine strenge Notengebung die Attraktivität des eigenen Schwerpunkts zu senken und damit weniger Studenten für die eigenen Veranstaltungen zu gewinnen oder gar die Schwerpunktgestaltung infrage zu stellen.
Mangels empirischer Erforschung und Erprobung dieser Maßnahmen ist bisher unklar, welche davon einen maßgeblichen Effekt hätte. Die Vereinheitlichung der Prüfungsbedingungen erscheint daher eher schädlich als nützlich. Sinnvoller wäre es, im föderalen Wettbewerb verschiedene Möglichkeiten zu erproben, die Qualität der Schwerpunktprüfung zu verbessern. Die Angabe eines Rankings im Zeugnis neben der Note könnte dabei verdeutlichen, ob mit einer guten Note auch ein gutes Abschneiden im Vergleich zu anderen Absolventen einhergeht. Je stärker Ranking und Note voneinander abweichen, desto eher sind die Länder gehalten, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sie sollten dem nachkommen können, ohne sich einer bundesweiten Abstimmung aussetzen zu müssen. Diese dauert nun schon Jahre. Gleichwohl hat sie keine genaueren Kenntnisse über die beklagte Uneinheitlichkeit hervorgebracht. Für den Umgang mit Ungewissheit hat sich auch in anderen Bereichen ein solcher Wettbewerb bewährt.
- Etwa Stephan Lorenz, Zurück in die Provinz, LTO, 3.1.2017.
- Beschluss vom 9.11.2017 der Justizministerkonferenz, Top I.1 Nr. 2.
- Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der Juristenausbildung, November 2017, S. 5.
- Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der Juristenausbildung, Herbst 2016, S. 13 ff.
- DJFT 2017/1, Nr. 2.
- So im Fall von Schleswig-Holstein, siehe dazu Kähler/Engel/Ritter, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2017, 133, 145 f.
- Zum Teil wird wie in Bremen eine Klausur aus dem Handels- und Arbeitsrecht gefordert, sodass nicht immer alle Klausuren übernommen werden können, § 18 Abs. 2 Nr. 1 JAPG Bremen.
- Michael Labe, Examensnoten, Kammerreport Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg 4/2013, S. 9.
- Bericht des Koordinierungsausschusses (Fn. 3), S. 26.
- Bericht des Koordinierungsausschusses (Fn. 3), S. 17.
- 10 Bundesländer nahmen an der Studie teil, Kähler/Engel/Ritter, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2017, 133, 137.
- Die Irrtumswahrscheinlichkeit betrug weniger als ein Promille, Kähler/Engel/Ritter, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2017, 133, 141.
- Kähler/Engel/Ritter, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2017, 133, 152 f.
- § 12 JAG NRW.
- § 18 JAPG Bremen.
- Bericht des Koordinierungsausschusses (Fn. 4), S. 10.
- Kähler/Engel/Ritter, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2017, 133, 152.
- § 18 Abs. 2 Nr. 1 a) JAPO Bayern.
- § 11 Abs. 2 Nr. 2 JAG NRW.
- Bundesjustizamt, Ausbildungsstatistik 2017, S. 2, 4.