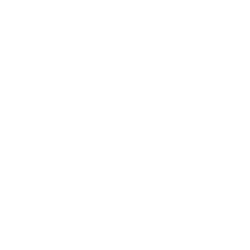Vor zehn Jahren veröffentlichte Niels Petersen einen Beitrag zur Frage, ob die Rechtswissenschaft eine »empirische Wende« brauche. Der Text provozierte vielfältige Reaktionen, darunter eine scharf formulierte Replik von Ino Augsberg gegen den »neuerdings erhobenen empiristischen Ton in der Rechtswissenschaft«. Zehn Jahre später greift ein R|E Online-Symposium die Debatte noch einmal auf: Sind wir heute klüger? Haben die Zeitläufte einer Seite Recht gegeben? Oder war es am Ende ein Streit, der sich an Begrifflichkeiten entzündete, gar ein Missverständnis? Die Initiatoren der Debatte und weitere Autoren beziehen zu diesen Fragen Stellung. (Red.)
I. Soziale Fakten bei der Normkonkretisierung
Niels Petersen und Ino Augsberg haben vor einigen Jahren im STAAT mit scharfen Argumenten und teils ebensolchen Worten über Empirie im Recht gestritten. Beider Rückblick auf diesem Blog klingt da schon viel versöhnlicher (hier und hier). Zwingend widersprüchlich sind Petersens und Augsbergs Positionen kaum, sie unterstreichen womöglich eher die von Oliver Lepsius geäußerte Beobachtung, dass Interdisziplinarität – jedenfalls in der Falllösungsperspektive – vonseiten der deutschen Rechtswissenschaft gerne integrativ, theoretisch und normativ unverbindlich (hier wird man den Augsbergschen Beitrag verorten müssen) und in der amerikanischen Tradition (der Petersen nahe steht) eher arbeitsteilig und unter Rückgriff auf die empirische Sozialforschung betrieben wird.1
Beide sind sich in ihren grundsätzlichen Forderungen nach einer disziplinären Öffnung der Rechtsarbeit2 einig. Beide wollen dabei aber auch die Aussagen der Nachbarwissenschaften nicht unangeleitet und frei jeder kritischen Würdigung in das Recht übernehmen. Die eingeforderte Kritik setzt dann zwar zunächst auf verschiedenen Abstraktionsebenen an. Doch selbst dies führt nicht zwingend zu einem Widerspruch. So verweist mitunter schon das Recht selbst auf die beiden hier angesprochenen Ebenen – beide mögen gar in ein und demselben Gerichtsverfahren unmittelbar zum Tragen kommen.
Gerade der Zivilprozess verweist offen auf einen subjektiven, relativen Wahrheitsbegriff, der hier nicht nur der Prozessökonomie dient, sondern auch die Funktion der Zivilgerichtsbarkeit betont, die eben nicht der objektiven Wahrheit, sondern zuvörderst einer effizienten Streitschlichtung im Gleichordnungsverhältnis verpflichtet ist: Wenn die eine Partei vorträgt, der streitgegenständliche Sachverhalt habe sich an einem Montag zugetragen und die andere Partei dem nicht widerspricht, dann bildet dies die fortan zugrunde zu legende zivilprozessuale Wahrheit jenes Verfahrens. Selbst wenn sich das Geschehene nach ansonsten verbreiteter Wahrheitsbeschreibung an einem Dienstag abgespielt haben sollte, ist dies für das Verfahren fürderhin ohne jede Relevanz. Die Wahrheit gerade des Zivilprozesses ist also gar nicht so verschieden von der Wahrheit des Theaters; sie trägt hier gar postmoderne Züge. Und dies ergibt sich mit Blick auf § 138 Abs. 3 ZPO zunächst ziemlich trocken aus dem Gesetz.
Im selben Verfahren – und damit nicht nur in den hohen Sphären hochgradig unbestimmter Verfassungssätze,3 sondern auch in den Niederungen unterinstanzlicher Zivilprozesse – mag das Gesetz aber auch ebenso trocken empirisches Wissen im Sinne von legislative facts4 einfordern. Was etwa eine mittelbare Diskriminierung im Sinne des § 3 Abs. 2 AGG ist, lässt sich eigentlich nur mithilfe empirischer Sozialforschung adäquat beantworten. Denn es geht nicht mehr bloß um den individuellen Sachverhalt, sondern um statistische Korrelationen, wenn etwa die klagende Arbeitnehmerin – um ein klassisches Beispiel zu bemühen – eine mittelbare Diskriminierung5 der Frau aus einer Schlechterstellung von Teilzeit- gegenüber Vollzeitbeschäftigten ableiten will.6 Man mag die verstärkte (hier sogar gesetzliche) Hinwendung zu sozialen Tatsachen begrüßen, die in Rechtsfiguren wie der mittelbaren Diskriminierung begründet liegen. Gerade für den Zivil- und den Arbeitsgerichtsprozess, die beide vom Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz getragen sind, ist dies aber auch ein Problem. Denn die klagende Arbeitnehmerin bräuchte für einen stichhaltigen Vortrag neben einer arbeitsrechtlich versierten Anwältin nunmehr auch solides sozialwissenschaftliches Material – hier jedenfalls über die Verteilung von Voll- und Teilzeitarbeit zwischen den Geschlechtern.7 Dies erhöht die Rechtsschutzkosten sowie das Prozessrisiko und es mag die Klägerin gar davon abhalten, überhaupt vor Gericht zu ziehen. Und so wissenschaftlich unbefriedigend es ist, wenn gerade die deutschen Gerichte sich allzu selbstbewusst ohne fremde Hilfe zur Erhebung und Beurteilung sozialer Tatsachen berufen sehen,8 so mag gerade die unbedarfte sozialwissenschaftliche Praxis der Justiz mancherorts zu einem Mehr an Rechtsschutz führen – auch wenn dies bedeutet, dass die Wahrheit des Gerichtsprozesses nur noch mehr von anderen Wahrheitsbeschreibungen abweicht.
Eine solche Divergenz kann also hinzunehmen sein, wenngleich etwa im Strafprozess oder bei der verfassungsgerichtlichen Normenkontrolle andere Anforderungen an die Interdisziplinarität der Rechtsfindung zu stellen sein dürften als im einfachen amtsgerichtlichen Zivilprozess.
II. Eine empirische Wende in der Rechtswissenschaft?
Die Rechtwissenschaft folgt freilich einer ganz anderen Logik als die Gerichte. Der Wunsch nach einem möglichst niedrigschwelligen Zugang sollte hier zwar etwa bei der Kommunikation der Forschungsergebnisse – so weit wie möglich – eine Rolle spielen, nicht jedoch bereits bei der Methodenwahl. Niels Petersen hat auf diesem Blog klargestellt, dass es ihm in seinem Aufsatz für den STAAT zunächst um die andere, die gerichtliche Perspektive auf die Empirie ging. Mit Konstantin Chatziathanasiou hat er im Archiv des öffentlichen Rechts kürzlich aber auch nach dem Stellenwert der empirischen Sozialforschung in der vergleichenden Verfassungsrechtswissenschaft gefragt.
Während sich die deutschen Gerichte immer noch schwertun, machen die beiden Autoren in der Wissenschaft einen deutlicheren Trend zu einem verstärkten Einsatz sozialwissenschaftlicher Methoden aus. Und in der Tat – womöglich wird die empirische Wende eher hier als dort zu beobachten sein. Dabei hat die Rechtswissenschaft allerdings immer schon auch „empirisch“ gearbeitet. Denn gerade die deutsche Rechtswissenschaft war ja stets dadurch gekennzeichnet, dass sie stark auf die Rechtsprechung fokussiert war.9 Und wo die Rechtswissenschaft Gerichtsentscheidungen sammelt, systematisiert und kommentiert, bilden diese das empirische Material, das zumindest den Ausgangspunkt der Forschung markiert. Die Beschäftigung mit diesem Material war und ist dabei zuvörderst eine qualitative. Darin muss die Rechtswissenschaft jedoch nicht verharren. Die gezielte Anreicherung der hergebrachten juristischen Hermeneutik um quantitative Methoden verspricht hier neue Erkenntnisse, wenngleich es auch hier natürlich bei der Warnung vor dem bloßen Theorientransfer, der nicht auch eine Theorientransformation umfasst,10 bleiben muss.
Wieder einmal ist die anglo-amerikanische Rechtswissenschaft erheblich weniger kontaktscheu als die deutsche. Aber auch hierzulande mehren sich in letzter Zeit Studien, die etwa versuchen, mit den Mitteln der Digital Humanities auch die Rechtswissenschaft zu bereichern.11 Andreas Fleckner und Corinna Coupette haben in diesem Zusammenhang bereits die „Quantitative Rechtswissenschaft“ ausgerufen.12
Ob die entsprechenden Bestrebungen in einen (weiteren) Empirical Turn münden mögen, bleibt abzuwarten. Vielleicht verhelfen sie aber dazu, einen plastischeren Blick auf das Recht zu gewinnen, indem sie der Forschung eine zusätzliche Perspektive aufzeigen. Jedenfalls deutet vieles darauf hin, dass es in Deutschland eher die Wissenschaft als die Justiz ist, die sich verstärkt diesen Formen der empirischen Sozialforschung zuwendet. Sie verfügt wohl auch einzig über die erforderlichen Ressourcen, um sowohl der ausdifferenzierten Methodik der Sozialwissenschaften als auch den Anforderungen an eine passgenaue Modellbildung und Integration der Ergebnisse ins Recht zu genügen.13 Beide Elemente lassen sich schließlich kaum noch in der Person einer einzelnen Forscherin zusammenführen. Interdisziplinäre Arbeit muss ab einem gewissen Punkt daher regelmäßig Teamarbeit sein, bei der die erforderlichen Übersetzungs- und Transformationsleistungen fortwährend und immer aufs Neue erbracht werden müssen. Hier liegt es nicht zuletzt an den Universitäten und Forschungseinrichtungen, die entsprechenden Strukturen für eine stärker empirisch arbeitende Rechtswissenschaft zu schaffen.
- Lepsius, Sozialwissenschaften im Verfassungsrecht – Amerika als Vorbild?, JZ 2005, S. 1 (12 und passim).
- Zum Begriff Müller/Christensen, Juristische Methodik, Band I, 11. Aufl. 2013, S. 39.
- Vgl. Lepsius (Fn. 1), S. 2 f.; Petersen, Braucht die Rechtswissenschaft eine empirische Wende?, DER STAAT 49 (2010), S. 435 (444).
- Grundlegend zu Unterscheidung von „adjudicative“ und „legislative facts“ Davis, An Approach to Problems of Evidence in the Administrative Procedures, Harvard Law Review 55, S. 364 (402 f.); Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, Harvard Law Review 89, S. 1281 (1282 f.).
- Auf diesem Blog zuletzt zur Begleitung von sogenannten Testings mittels Korrespondenzstudien Hamann, Juristische Korrespondenzexperimente, Rechts|Empirie v. 20.10.2020.
- Siehe nur EuGH, Rs. 170/84 (Weber von Hartz vs. Bilka), Slg. 1986, 1620 ff.
- Eine Frage der juristischen Anleitung des erforderlichen empirischen Wissens wäre es sodann, rechtskonkretisierend festzulegen, in welchem Rahmen die Geschlechterverteilung bei Voll- und Teilzeitarbeit zu untersuchen ist. Muss ein Missverhältnis im konkreten Betrieb, in der spezifischen Branche oder gesamtgesellschaftlich bestehen, um den Tatbestand einer mittelbaren Diskriminierung zu begründen?
- Siehe etwa die im Ergebnis zwar naheliegende aber nicht näher belegte Annahme einer (tatbestandlichen) mittelbaren Benachteiligung wegen des Geschlechts durch ein Verbot des Tragens religiöser Abzeichen in BVerfGE 138, 296 (358).
- Für das Verfassungsrecht siehe nur das berühmte Diktum vom „Verfassungsgerichtspositivismus“ von Schlink, Die Entthronung der Staatsrechtswissenschaft durch die Verfassungsgerichtsbarkeit, DER STAAT 28 (1989), S. 161 (163).
- Augsberg, Von einem neuerdings erhobenen empiristischen Ton in der Rechtswissenschaft, DER STAAT 51 (2012), S. 117 (123).
- Für quantitativen Rechtsprechungsanalysen an einem Korpus von BVerfG-Entscheidungen, siehe etwa erste Studien der L.L.Con-Gruppe an der Humboldt-Universität zu Berlin: Wendel, Welche Grundrechte führen zum Erfolg?, JZ 2020, S. 668 ff.; Ighreiz/Rolfes/Möllers/Shadrova/Tischbirek, Karlsruher Kanones?, AöR 3/2020 (im Erscheinen).
- Fleckner/Coupette, Quantitative Rechtswissenschaft, JZ 2018, S. 379 ff.
- Vgl. Chatziathanasiou, Interdisziplinäre Rechtswissenschaft, Rechts|Empirie v. 25.11.2020.