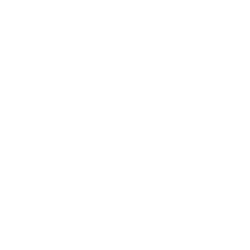Vor zehn Jahren veröffentlichte Niels Petersen einen Beitrag zur Frage, ob die Rechtswissenschaft eine »empirische Wende« brauche. Der Text provozierte vielfältige Reaktionen, darunter eine scharf formulierte Replik von Ino Augsberg gegen den »neuerdings erhobenen empiristischen Ton in der Rechtswissenschaft«. Zehn Jahre später greift ein R|E Online-Symposium die Debatte noch einmal auf: Sind wir heute klüger? Haben die Zeitläufte einer Seite Recht gegeben? Oder war es am Ende ein Streit, der sich an Begrifflichkeiten entzündete, gar ein Missverständnis? Die Initiatoren der Debatte und weitere Autoren beziehen zu diesen Fragen Stellung. (Red.)
Ino Augsberg hat mit seiner Replik zu meinem Beitrag Braucht die Rechtswissenschaft eine empirische Wende? (Der Staat 2010, S. 435 ff.) der wichtigen Debatte um die Rolle der Empirie in der Rechtswissenschaft viel Aufmerksamkeit verschafft (Der Staat 2012, S. 118 ff.). Allerdings sind die inhaltliche Differenzen unserer Positionen – abgesehen vom theoretischen Vorverständnis und der Terminologie – geringer, als es den Anschein haben mag. Mein Beitrag zur empirischen Wende in der Rechtswissenschaft beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit dogmatische Rechtswissenschaft und juristische Praxis empirische Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften berücksichtigen können und sollen. Ich entwickele drei Argumente:
- Erstens weise ich darauf hin, dass das Recht keineswegs ein autonomes, gegenüber Erkenntnissen aus anderen Wissenschaften vollkommen abgeschlossenes System ist. Vielmehr gibt es in juristischen Argumentationsfiguren Öffnungen, die einen Blick über den rechtlichen Tellerrand hinaus verlangen (S. 439-446).
- Zweitens mache ich auf die Gefahren aufmerksam, die mit einer solchen Öffnung verbunden sind. Das betrifft zum einen das, was ich in anderem Kontext als Allgemeinwissensfehlschluss bezeichnet habe. Bei der Interpretation sozialwissenschaftlicher Daten sollten wir die methodischen Regeln beachten, die in den Sozialwissenschaften entwickelt wurden. Ansonsten laufen wir Gefahr, voreilige Schlüsse zu ziehen, die von den interpretierten Daten nicht gedeckt werden (S. 447-451).
- Drittens habe ich für die normativen Wertungen sensibilisieren wollen, die sozialwissenschaftlichen Studien inhärent sind. Letztere sind der Grund, warum wir sozialwissenschaftliche Ergebnisse nicht unhinterfragt in den juristischen Kontext übertragen können (S. 451-454).
In seiner Replik stimmt Augsberg mir in allen diesen drei Punkten zu. Auch wenn er für eine „juridische Konstruktion von Realität“ streitet, sieht er doch die Notwendigkeit des Austausches mit den Sozialwissenschaften (S. 121). Auch meine beiden Warnungen akzeptiert Augsberg als berechtigt. So tritt er einem „aufs Geratewohl erfolgende[n] Hantieren mit aus den Sozialwissenschaften entlehnten Versatzstücken“ entgegen (ebd.) und bekräftigt damit meine Forderung, die sozialwissenschaftliche Beobachtungen der Wirklichkeit in ihrem methodischen Kontext zu verstehen. Gleichzeitig ist es auch ihm ein Anliegen, die impliziten normativen Wertungen empirischer Studien bei der rechtswissenschaftlichen Nutzbarmachung zu berücksichtigen (S. 123). Differenzen ergeben sich vor allem aus Terminologie und Perspektive. Augsberg scheint es in erster Linie um die Einpassung sozialwissenschaftlicher Theorien in die rechtswissenschaftliche Theoriebildung zu gehen. Dagegen beschäftigt sich mein Text zuvorderst mit dem Umgang mit legislative facts durch Gerichte.
In seinem inhaltlich klaren und stilistisch gelungenen Parallelbeitrag verwendet Augsberg eine schöne Metapher, die des Theaters, um die Möglichkeit unterschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen und die Komplexität deren normativer Bewertungen zu illustrieren. Sind aber die Rechtsdogmatik und die Rechtwissenschaft bei der eigenen Wirklichkeitskonstruktion so frei wie das Theater? Um ein aktuelles Beispiel zu geben: Die Richterin Amy Coney Barrett, die derzeit für einen Posten als Richterin am U.S. Supreme Court nominiert ist, hat in den Anhörungen vor dem Senat Zweifel an der Verursachung des Klimawandels durch den Menschen geäußert. Steht es Richtern – wie der Theaterregie – tatsächlich frei, in den einschlägigen Wissenschaften kaum kontroverse Erkenntnisse einfach zu ignorieren?
Implizit weist Augsberg natürlich auf ein wichtiges Problem hin: Wie sollen wir als Juristen damit umgehen, dass jegliche Beschreibung der Wirklichkeit mit Unsicherheit behaftet ist? Anders gewendet: Unter welchen Bedingungen können Gerichte davon ausgehen, dass sozial-, geistes- oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse ausreichend gesichert sind, um juristische Entscheidungen auf diese stützen zu können? Mein Beitrag gibt – ebenso wie Augsbergs Replik – keine positive Antwort darauf. Ich warne lediglich vor zwei typischen Gefahren, die Juristen bei der Rezeption sozialwissenschaftlicher Studien unterlaufen.
Die Frage des Umgangs mit Unsicherheit im Recht war in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher juristischer Untersuchungen. Ich selbst habe mich – im Anschluss an meinem hier skizzierten Beitrag – insbesondere in meiner Habilitationsschrift mit ihr beschäftigt. Gerade im öffentlichen Recht arbeiten Gerichte bei der Kontrolle von Exekutive und Legislative oft mit Einschätzungsspielräumen. Sie schreiben Gesetzgeber und Exekutive nicht vor, von welcher konkreten Wirklichkeitsbeschreibung sie auszugehen hatten, sondern gewähren ihnen in dieser Hinsicht einen Spielraum. Allerdings ist dieser Spielraum regelmäßig nicht grenzenlos. Insofern müssen Gerichte etwas zu der Frage sagen, wann Gesetzgeber oder Exekutive von unvertretbaren empirischen Annahmen ausgegangen sind. Das setzt jedoch voraus, dass Gerichte Standards haben, um zu bestimmen, wann Gesetzgeber oder Exekutive Annahmen getroffen haben, die sozial- oder naturwissenschaftlich nicht mehr vertretbar sind.
Gerichte haben zwei mögliche Strategien, direkten Aussagen über die Vertretbarkeit sozialwissenschaftlicher Aussagen zu entkommen. Eine insbesondere in der Literatur populäre Strategie ist der Rückgriff auf prozedurale Argumente. Die gesetzgeberische Entscheidung bewegt sich so lange im Rahmen des legislativen Einschätzungsspielraums, wie die Entscheidung in einem „guten“ Verfahren getroffen worden ist. Allerdings sind die Maßstäbe dessen, was ein solches „gutes“ Verfahren ausmacht, unklar. Einig ist man sich lediglich, dass die Anforderungen über die bloß formale Legalität des entsprechenden Rechtsaktes hinausgehen muss.
Eine zweite Möglichkeit, der Kontrolle gesetzgeberischer Einschätzungsspielräume ist eine sog. Motivkontrolle. Bei dieser stellt man fest, ob der Gesetzgeber tatsächlich im Gemeininteresse gehandelt oder möglicherweise privatnützige Ziele verfolgt hat. Aber auch eine solche Motivkontrolle ist nicht frei von Problemen: Zum einen ist es oft schwierig, die Motivation des Gesetzgebers zu identifizieren. Zum anderen kann sie lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Wahrung des gesetzgeberischen Einschätzungsspielraums sein.
Insofern entbindet auch die Konstruktion von Einschätzungsspielräumen Gerichte in letzter Konsequenz nicht vollständig von der Aufgabe, etwas zur Plausibilität gesetzgeberischer Prognosen zu sagen. Letztlich werden sich Gerichte nicht am Maßstab vollständiger theoretischer Konsistenz orientieren können. Abgesehen von den beiden von mir vor zehn Jahren formulierten Warnungen vor einem unreflektierten Umgang mit sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen kommen sie nicht umhin, pragmatisch zu agieren.
Im Umgang mit sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen in der Rechtsdogmatik gibt es noch ein weiteres Problem. Zu vielen Fragen, die dogmatisch arbeitende Rechtswissenschaftler interessieren, gibt es keine konkrete empirische Forschung. Dafür kann man verschiedene Gründe ausmachen – den mangelnden Dialog zwischen den verschiedenen Disziplinen, methodische Zwänge gerade in den quantitativ-empirisch arbeitenden Sozialwissenschaften sowie die Anreizstrukturen in den unterschiedlichen Fächern, die einer Fachgrenzen übergreifenden Kooperation entgegenstehen. Interdisziplinäre Kooperationen zu dogmatischen Fragen wie die in meinem damaligen Beitrag angesprochene Studie von Emanuel Towfigh und Andreas Glöckner zur Qualifikation der Sportwette als Glücksspiel sind daher die Ausnahme.
Zwar gab es in der Diskussion auch Forderungen nach einer stärker rechtsdogmatischen Ausrichtung der quantitativ-empirischen Rechtsforschung. Dennoch hat diese sich in den letzten Jahren eher in solchen Bereichen dynamisch entwickelt, in denen Rechtswissenschaftler nicht dogmatisch arbeiten. Dies gilt aus öffentlich-rechtlicher Sicht insbesondere für die Verfassungsvergleichung. Dort gab es in diesem Jahrzehnt eine Proliferation an Studien, die die Konsequenzen eines bestimmten institutionellen Designs oder die Gründen für die Wahl eines solchen Designs untersuchen. Gleichzeitig gibt es auch eine große Zahl an Untersuchungen, die sich mit den in der Verfassung garantierten Grundrechten beschäftigen. Diese analysieren etwa die Diffusion oder die Effektivität von Grundrechten. Auch wenn man an vielen dieser Studien methodische Kritik üben kann, ergänzen sie die rechtswissenschaftliche Diskussion doch um eine neue Perspektive. Ein weiterer Bereich empirischer Forschung mit rechtswissenschaftlichem Bezug ist die Richterforschung. Diese untersucht Faktoren, die Entscheidungen von Richtern beeinflussen oder gar determinieren. Diese wird bisher überwiegend von Politikwissenschaftlern betrieben. Eine Zunahme an rechtswissenschaftlichen Perspektiven wäre hier sicherlich eine Bereicherung.
Wir können in der Rechtswissenschaft also durchaus – wenn vielleicht keine empirische Wende – so doch eine zunehmende Popularität empirisch geprägter Forschung beobachten. Anders als von mir vor zehn Jahren diskutiert, bezieht sich diese Entwicklung aber nicht auf die dogmatische Rechtswissenschaft. Vielmehr sehen wir eine Zunahme empirischer Studien, die sich vor allem aus beobachtender Perspektive mit dem Recht beschäftigt. Diese Forschung wird allerdings von der deutschen Rechtswissenschaft bisher nur verhalten begleitet. Dabei wäre eine verstärkte Hinwendung durchaus wünschenswert – allein schon, um in der internationalen Diskussion auch die deutsche Perspektive angemessen zu repräsentieren.