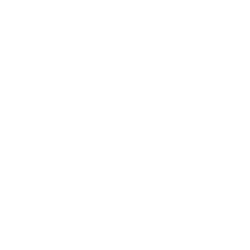Markus Söder und viele andere Politiker sprechen bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie von einem zu akzeptierenden „Primat der Wissenschaft“. Das ist richtig, insofern es um eine Optimierung von Strategien zur effektiven Bekämpfung des Virus geht, und insoweit falsch, als es die Notwendigkeit komplizierter Abwägungsentscheidungen maskieren soll, worauf nicht zuletzt Jan-Erik Schirmer zutreffend hingewiesen hat.
Doch es stellt sich ein viel komplexeres Problem. Die Wissenschaftler*innen forschen unter einer defizitären sowie dynamischen empirischen Datenlage, da ständig neue Informationen über SARS-CoV-2 und die dadurch ausgelöste Krankheit COVID-19 gewonnen werden können, jedoch gleichzeitig bei allen Daten – die aus guten Gründen schnell der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden – eine gewisse Vorsicht und mitunter auch methodischer Zweifel angebracht ist. Es ist gerade keine Schande, sondern Auszeichnung der Wissenschaft, wenn sie ihre Erkenntnisse verändert, anpasst und verbessert, wie etwa wenn Christian Drosten seine Meinung zu Ausgangssperren bzw. -beschränkungen änderte.
So wissenschaftlich wünschenswert dies sein mag, so kontraproduktiv scheint es auf den ersten Blick für Regulierungsaufträge an die Politik zu sein. Denn ließe man sich bei jeder wissenschaftlichen Kehrtwende zu neuen Maßnahmen hinreißen, würde nicht nur das Vertrauen in Politik und Wissenschaft erschüttert, sondern zudem ein untragbar rechtsunsicherer Zustand geschaffen.
Wie soll man demnach mit Regulierung trotz einer solch defizitären und dynamischen empirischen Datenlage umgehen? Ein Abwarten (wait and see, vgl. Finck, 19 German Law Journal 2018, 665, 675 f.) scheidet in Anbetracht der Dringlichkeit einer Regulierung aus. Vielmehr sollte die wissenschaftliche Hinterfragungsmethodik auf die Politik so übertragen werden, dass kein rechtsunsicherer, aber doch ein anpassungsfähiger Zustand entsteht. Ähnlich der Evolution kommt es demnach auf die Schaffung von richtigen Feedbackmechanismen an, sodass durch ein trial–and–error-Verfahren bessere Regulierungen die vorigen ersetzen können, sobald hierzu neue Daten vorliegen (vgl. hierzu übertragbar Podszun, in: Möslein, Regelsetzung im Privatrecht, 2019, § 11 und Gumpp, ZBB 2020, Heft 2, im Erscheinen, sub IV.2.4; allgemein aus einer methodischen Perspektive Hamann, Evidenzbasierte Jurisprudenz, 2014, § 2).
Ganz konkret bietet es sich an (auch losgelöst von der verfassungsrechtlichen Dimension einer zeitlichen Dauer, vgl. nur Thorsten Kingreen im Verfassungsblog und Andrea Kießling im JuWissBlog), den Maßnahmen – insbesondere den Ausgangsbeschränkungen bzw. dem Aufenthaltsverbot an öffentlichen Orten – eine zeitliche Dimension hinzuzufügen. Im englischen Sprachraum spricht man hierbei von sunset clauses, einer Art Befristung oder auflösenden Bedingung für die Geltung eines Rechtsaktes, sollte dieser nicht vom Rechtsaktgebenden neuerlassen werden (bspw. auch Art. 115k Abs. 2 GG jedoch ohne Möglichkeit des Neuerlasses). Solche zeitlichen Beschränkungen halten den Rechtsetzenden zur Reflexion an und bieten die Möglichkeit, die Effektivität der bisherigen Maßnahmen zu evaluieren und aufgrund neuer wissenschaftlicher Einschätzungen feinzujustieren.
Gleichzeitig muss ein solches Evaluationssystem unmittelbar mit neu (zu) erlassen(d)en Maßnahmen verbunden werden. Die Frage danach, ob eine Maßnahme Erfolg verspricht, ist gerade nicht nur vor ihrem Erlass, sondern insbesondere auch danach zu stellen. Dies wird oft übersehen, sodass die Effektivität vorher ergangener Rechtsakte mitunter kaum überprüfbar ist. Aufgrund der deutlich verspäteten Zahlen der Corona-Infizierten kann eine Ausgangsbeschränkung – um bei diesem Beispiel zu bleiben – sinnvollerweise nicht nach bloß zwei Wochen evaluiert werden, wenn man bedankt, dass die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (oder selbst die der Johns-Hopkins-Universität) Verzögerungen ausgesetzt sind: Inkubationszeit von im Median fünf bis sechs Tagen + diagnostische Verzögerung (der Zeit, bis der Test gemacht wird/werden kann/darf und die Testergebnisse vorliegen) von unbekannter Dauer + die Veröffentlichungsdauer. Sinnvoller erscheint es demnach, erst die Daten, die nach dem Ablauf von mindestens zwei Wochen time lag neu gewonnen werden, für die Beurteilung der Ausgangsbeschränkungen heranzuziehen. Hierbei kann sodann festgestellt werden, inwiefern sich die Ansteckungsrate durch die Maßnahmen verringert hat und es können entsprechende regulatorische Anpassungen vorgenommen werden.
Ferner sollte man dem Drang nach Schwarz-Weiß-Lösungen – Ausgangssperre oder völlige Freiheit – widersagen. Es ließen sich auch Mittelwege testen, wie etwa die komplette Ausgangssperre für alle Nichtrisikogruppen an manchen Tagen und die komplette Ausgangssperre für alle Risikogruppen an den anderen, um somit die Einschränkungen der Wirtschaft zu mildern und gleichzeitig die besonders gefährdeten Gruppen in gleichen Maße zu schützen (vorausgesetzt, eine momentan befürchtete Ansteckungsgefahr über Oberflächen lässt sich bspw. durch rigorose Desinfektion mildern). Maßstab sollte bei alledem bleiben, dass die Maßnahme stets auf ihre Wirksamkeit und Rechtfertigung überprüft wird.
Folglich ist das Hin und Her der Wissenschaft nur auf den ersten Blick hinderlich. Tatsächlich bietet sich die Chance, von diesem Reflexionsprozess auch für Regulierungsstrategien zu lernen. Hierfür muss freilich vorsichtiger agiert werden, da Bürger*innen nicht ständig wechselnden Regeln ausgesetzt werden können. Gleichzeitig kann der Föderalismus als Wettbewerb der Bekämpfungsstrategien seine Schlagkraft dann am meisten entfalten, wenn sich die Bundesländer auf eine einheitliche und vergleichbare Überprüfungsstrategie einigen könnten. Denn schon jetzt fahren unterschiedliche Bundesländer zumindest teilweise andere Bekämpfungsstrategien, was aber nur dann wirklich gewinnbringend genutzt werden kann, wenn man das Realexperiment verschiedener Ansätze zur Bekämpfung des Virus auch einer einheitlichen empirischen Analyse dergestalt unterziehen kann, dass zukünftige Regeln von dem Vergleich der Maßnahmen und ihrer Effektivität lernen können.
Das „Primat der Wissenschaft“ sollte also doppelt verstanden werden. Erstens ist die medizinische Aufarbeitung der Maßstab für alle denkbaren Lösungsmöglichkeiten. Zweitens kann ein Wettbewerb der Strategien – wie ein wissenschaftlicher Wettbewerb der Ideen – bei entsprechender Überprüfung, Vergleichen und Effektivitätsanalysen bessere Bekämpfungsstrategien hervorbringen. Bund und Länder sollten beide Facetten zur Krisenbewältigung nutzen.