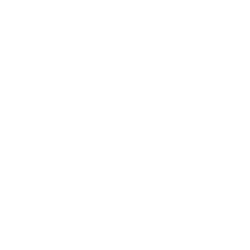Vor zehn Jahren veröffentlichte Niels Petersen einen Beitrag zur Frage, ob die Rechtswissenschaft eine »empirische Wende« brauche. Der Text provozierte vielfältige Reaktionen, darunter eine scharf formulierte Replik von Ino Augsberg gegen den »neuerdings erhobenen empiristischen Ton in der Rechtswissenschaft«. Zehn Jahre später greift ein R|E Online-Symposium die Debatte noch einmal auf: Sind wir heute klüger? Haben die Zeitläufte einer Seite Recht gegeben? Oder war es am Ende ein Streit, der sich an Begrifflichkeiten entzündete, gar ein Missverständnis? Die Initiatoren der Debatte und weitere Autoren beziehen zu diesen Fragen Stellung. (Red.)
Als angehende Juristin und Physikerin, die beide Methoden aus beiden Disziplinen kennt und anwendet, wage ich mich nun an die Frage ob und inwiefern die Rechtswissenschaft eine empirische Wende erfährt und wo wir diese heute finden. Als Studentin, die am Beginn Ihrer Karriere steht, frage ich mich ob – und wenn ja, in welchem Ausmaß – ich empirische Fertigkeiten in meinem Beruf zukünftig brauchen werde.
Es ist allseits bekannt, dass die Empirie in den Naturwissenschaften, wie der Physik, eine zentrale Rolle spielt. Eine Teilchenphysikerin, die die Eigenschaften von Atomen untersucht, stellt eine Hypothese auf, führt das Experiment aus, indem sie Atome mit einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit gegeneinanderprallen lässt und beobachtet. Sie sammelt und wertet die gewonnenen Daten aus und verifiziert oder falsifiziert die gestellte Hypothese. Physiker*innen erfassen methodisch-systematisch Daten, die objektiv, wiederholbar und überprüfbar sind. Methoden, die sich auf wissenschaftliche Erfahrung stützen, um Erkenntnisse zu gewinnen, ist – einfach erklärt – Empirie. Die aufgestellte Hypothese hat solange Gültigkeit bis sie durch ein anderes Experiment falsifiziert wird. Und so beschreiben Physiker*innen die Gesetze der Natur, beschreiben das was ist.
Die Rechtswissenschaft beschäftigt sich regelmäßig mit Rechtsregeln, die das Verhalten des Menschen beeinflussen sollen. Als normative Wissenschaft beschreibt und untersucht sie nicht das was ist, sondern was sein soll. Sie untersucht sowohl die Entstehung als auch die Anwendung von Normen und Rechtsquellen. Doch finden sich Schnittstellen zwischen dem Sein und Sollen? Besteht das Recht tatsächlich losgelöst von der tatsächlichen Sachlage, der Wirklichkeit, wie es in einem Theater der Fall sein mag?
Die Rolle der Empirie in der Legislative
Eine treibende Kraft, die die Rolle der Empirie im Gesetzgebungsprozess gestärkt hat, mag die Corona-Pandemie sein. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Corona-Krise bei Erlass von Corona-Gesetzen und Verordnungen verstärkt auf empirische Untersuchungen zurückgegriffen, die heute die Art wie wir leben stark bestimmen. Zahlen, Statistiken, Wahrscheinlichkeitsrechnungen mittels Computermodellen, mathematische Modelle zur Vorhersage von Clusterbildungen sind empirisch bedingt und heute Grundlage für den Zeitpunkt des Erlasses, die Dauer und das Ausmaß von gesetzlichen Maßnahmen zu Eindämmung von Infektionszahlen. Welcher Abstand muss eingehalten werden, wo kommt es zu Clusterbildungen, ist die Verwendung einer (und wenn ja, welcher) Maske erforderlich, um die Infektionszahlen einzudämmen – das sind Fragen, die empirisch bedingt sind. Empirisch bedingte Untersuchungen von Virolog*innen und anderen Expert*innen sind hier gefragt und notwendig um sachgerechte Regelungen erlassen zu können. Die Bundesminister*innen arbeiten eng mit der in Österreich eingerichteten Corona-Kommission zusammen, die die epidemiologische Situation wöchentlich einschätzen und als beratendes Gremium für den Erlass bundesweiter Maßnahmen dient. Die Legislative (sowie die Exekutive, insbesondere die Bundesminister*innen) sind heute wie nie zuvor angehalten, sich verstärkt mit den empirisch gewonnen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Die Corona-Pandemie stellt hier ein Paradebeispiel dafür, wie das Sein und Sollen miteinander wechselwirken und wie das Recht die tatsächliche Sachlage und das Erfahrungswissen berücksichtigt.
Die Rolle der Empirie in der Judikative
In der österreichischen (sowie in der deutschen) Rechtsordnung finden sich über viele Rechtsgebiete Formulierungen wie „ortsübliche Benutzung“ (§ 364 Abs. 2 ABGB), „Übung des redlichen Verkehrs“ (§ 914 ABGB), „geltende Gewohnheiten und Gebräuche“ (§ 346 UGB) oder „Verkehrssitte“ (§ 864 ABGB). Diese Formulierungen zwingen Jurist*innen, einen Blick in die Wirklichkeit zu werfen und die tatsächliche Sachlage zu erkennen. Ob und wann eine ortsübliche Benutzung oder Verkehrssitte vorliegt, bedarf einer zeitgemäßen empirischen Untersuchung. Verkehrssitten ändern sich mit der Zeit, die Welt unterliegt einem ständigen Wandel, der durch die Digitalisierung noch schneller vorangetrieben wird, sodass eine „Verkehrssitte“ oder eine „geltende Gewohnheit“ in einer bestimmten Branche, die von einem Gericht vor wenigen Jahren als solche erkannt wurde, heute vielleicht nicht mehr Verkehrssitte oder geltende Gewohnheit ist.
Empirie und Legal Tech
Das Zeitalter der Digitalisierung und damit auch zwangsläufig der Legal Technology (kurz Legal Tech) hat auch in der Rechtsbranche unlängst begonnen, auch wenn Legal Tech noch stiefmütterlich behandelt wird. Jurist*innen, insbesondere Großkanzleien, sind vermehrt daran interessiert, empirisch zu arbeiten, indem sie Daten erheben, auswerten und analysieren (lassen), um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Rechtsmarkt zu verschaffen. Zu nennen ist hier beispielsweise Legal Analytics, bei welcher öffentlich vorhandene Daten ausgewertet werden, um beispielsweise die Entscheidungsmuster von Richter*innen und anderen staatlichen Stellen zu erkennen. Diese können für Kanzleien als wichtige Informationsgrundlage dienen. Vermehrt werden nun auch Legal Tech Hackathons von Universitäten organisiert, bei welchen Studierende der Rechtswissenschaften mit Studierenden der Informatik gemeinsam an Legal Tech Tools arbeiten und dabei u.a. auch empirische Daten auswerten. Im Rahmen des „Second Chance Hackathons“ an der Santa Clara University (CA) wurde beispielsweise die Lücke zwischen Personen, die ihr Strafregister gelöscht hatten und jenen, die dies nicht taten aber anspruchsberechtigt waren, empirisch untersucht. Die erhobenen Daten haben ergeben, dass in einigen Staaten eine Lücke besteht, unter anderem weil Anspruchsberechtige kein Geld oder keine Zeit haben, oder nicht wissen, dass sie anspruchsberechtigt sind. Im Rahmen des Hackathons entwickelten Jurist*innen, data scientists und Informatiker*innen ein Programm (mittels Python), welches den Löschungsprozess automatisiert.
Fazit
Die Rechtswissenschaft betreibt selbst keine Empirie, wie sie in den Naturwissenschaften gekannt und gelebt wird; sie greift jedoch vermehrt auf empirische Untersuchungen von anderen Disziplinen zurück. Jurist*innen sind m.E. heute (noch) nicht Produzent*innen empirischer Forschung.
Niels Petersen und Ino Augsberg stellen die Frage, wie Jurist*innen damit umgehen sollen, dass jegliche Beschreibung der Wirklichkeit mit Unsicherheit behaftet ist. Unter welchen Bedingungen können Gerichte davon ausgehen, dass sozial-, geistes- oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse ausreichend gesichert sind, um juristische Entscheidungen auf diese stützen zu können?
Es ist ein Faktum, dass jedes natur- oder sozialwissenschaftliche Ergebnis mit einer (u.a. statistischen) Unsicherheit behaftet ist. Es ist – zu Recht – ein zwingender Bestandteil jeder empirischen Erkenntnisforschung. Eine andere Frage, die sich mir stellt, ist jedoch folgende: Sind (angehende) Jurist*innen mit empirischen Methoden soweit vertraut, dass sie selbständig einschätzen und reflektieren können, was empirisch erworbene Ergebnisse in einem bestimmten Kontext bedeuten? Können diese Kenntnisse im Rahmen des Studiums erworben werden oder bedarf es eines Doppelstudiums? Jurist*innen müssen nicht zwangsläufig zu Produzenten empirischer Forschung werden, doch sollten wir in der Lage sein, mit sozial-geistes-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen reflektiert umzugehen.