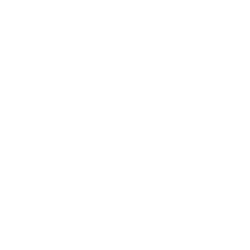Vor zehn Jahren veröffentlichte Niels Petersen einen Beitrag zur Frage, ob die Rechtswissenschaft eine »empirische Wende« brauche. Der Text provozierte vielfältige Reaktionen, darunter eine scharf formulierte Replik von Ino Augsberg gegen den »neuerdings erhobenen empiristischen Ton in der Rechtswissenschaft«. Zehn Jahre später greift ein R|E Online-Symposium die Debatte noch einmal auf: Sind wir heute klüger? Haben die Zeitläufte einer Seite Recht gegeben? Oder war es am Ende ein Streit, der sich an Begrifflichkeiten entzündete, gar ein Missverständnis? Die Initiatoren der Debatte und weitere Autoren beziehen zu diesen Fragen Stellung. (Red.)
I.
An einem trüben, verregneten Oktobersamstag beschloss M., nach längerer Zeit endlich einmal wieder ins Theater zu gehen, wie er es früher häufig gemacht hatte. Gedacht, getan; noch am selben Abend saß er im Zuschauerraum der altehrwürdigen Bühnen seiner Heimatstadt. Gezeigt wurde ein Klassiker; die Inszenierung erschien M. in ihrer etwas gezwungenen Adaption an aktuelle politische Fragen eher konventionell und vorhersehbar, also langweilig. Gegen Anfang des dritten Aufzugs geschah dann aber doch noch etwas Überraschendes. Plötzlich stand in der Reihe vor M. ein Mann auf und rief laut in den Saal hinein: „Das ist gar nicht Maria Stuart! Ich kenne diese Frau, das ist meine Nachbarin, die heißt Alexandra Kowalski!“
Diese Geschichte ist nicht wirklich passiert. Sie ist fiktiv; ich habe mir das ausgedacht. Eben deswegen kann sie aber dazu dienen, das komplizierte Verhältnis zu verdeutlichen, das zwischen der sogenannten Wirklichkeit im Singular und unseren Vorstellungen davon besteht. (Eine solche Verdeutlichung möchte ich im Folgenden versuchen. In Klammern hinzugefügt finden sich einige ergänzende Anmerkungen zu dem äußerst klaren und instruktiven Parallel-Beitrag von Niels Petersen. Wie Petersen denke auch ich, dass die Überschneidungen zwischen unseren Sichtweisen sehr viel größer sind als die Differenzen. Weniger sicher bin ich mir allerdings – und damit beginnen dann doch wieder verbleibende Differenzen –, ob man Unterschiede in „Vorverständnis“, „Perspektive“ und „Terminologie“ vom Inhalt der jeweiligen Position so weitgehend abtrennen kann, dass Differenzen auf der einen Seite nicht notwendig solche auf der anderen nach sich ziehen. Was, wenn Vorverständnis, Sprache und Perspektive maßgeblich dafür verantwortlich sein sollten, was überhaupt erkannt werden kann? Vielleicht betreffen unsere unterschiedlichen Perspektiven und Schreibweisen im Ergebnis tatsächlich eher Details – aber gerade in diesen sollen doch sowohl der Teufel wie der liebe Gott stecken.)
An den Anfang dieser Verdeutlichung lässt sich eine ganz einfache Frage stellen: Was wird sich M. in diesem Moment gedacht haben? Was würden Sie selbst in einer solchen Situation im Theater denken? Die nächstliegende Vermutung dürfte im gegebenen Kontext lauten, dass das Ganze ein Regieeinfall ist. Das Geschrei des Mannes wäre demnach eine immersive Performance, die als solche Teil der Gesamtinszenierung ist. Diese Vermutung hängt nicht nur, positiv, von der Kenntnis bestimmter, mittlerweile längst etablierter Verfahren im Theaterbetrieb ab, die sich die „Aufhebung der vierten Wand“ auf die Fahnen geschrieben haben. Die Vermutung verdeutlicht vielmehr zugleich, negativ, wie ungewöhnlich und sozial inadäquat das geschilderte Verhalten ist. (Auch) aus diesem Grund suchen wir nach einer Erklärung, die besser in unser in diesem Rahmen übliches Erwartungsschema passt und uns die Peinlichkeit des sozialen faux pas erspart.
Die fiktive Szene enthüllt also etwas über gesellschaftliche Üblichkeiten und die ihnen entsprechenden Erwartungshaltungen sowohl im Theater als auch im allgemeinen sozialen Miteinander. Bemerkenswert ist an dem Geschehen aber noch etwas Anderes: Die gewisse Peinlichkeit, die in dem skizzierten Verhalten liegt, ist weitgehend unabhängig von der Wahrheit der Aussage. Auch wenn der Mann recht hat, also die Dame auf der Bühne wirklich seine Nachbarin ist und Kowalski heißt, ändert das offenbar an der Inadäquatheit des Verhaltens nichts. Das Verhalten bleibt falsch, selbst wenn die Aussage richtig ist. Aber warum?
II.
Ein erster Erklärungsversuch könnte an der allgemeinen Differenz von Normativität und Faktizität ansetzen und diese in einer bestimmten Hinsicht näher erläutern. Wahrheit als adaequatio rei et intellectus und ihre aussageförmige Mitteilung ist danach nicht das einzige und nicht einmal das primär relevante Kriterium für sozialadäquates Verhalten. Was im sozialen Miteinander gefordert wird, sind (auch) andere Qualitäten als eine ehrliche Antwort, etwa auf die Frage, für wie intelligent oder gutaussehend man seinen Gesprächspartner eigentlich halte. Die Rigidität, ein „vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lügen“, radikal zurückzuweisen, selbst wenn die sozialen Kosten für eine derartige unbedingte Wahrheitspflicht denkbar hoch ausfallen, erscheint offenbar kaum noch plausibel. Vielmehr wird die radikale Position des magis amica veritas durch eine andere, die möglichen Kollateralschäden solcher Informationen einkalkulierende Perspektive ergänzt und zumindest in Teilen konterkariert. Beispielsweise die Diskussionen über die Genauigkeit von Polizeiberichten im Allgemeinen und etwaige Informationen zum persönlichen (Migrations-)Hintergrund von Tatverdächtigen im Besonderen zeugen von dieser Verknüpfung gesinnungs- und verantwortungsethischer Motive. Es gibt demnach offenbar gute normative Gründe, nicht immer und stets die volle Wahrheit laut auszusprechen – ob im Theater oder andernorts.
III.
Das Verhältnis von Normativität und Wirklichkeit lässt sich aber auch noch in einer zweiten Hinsicht für die Erklärung der Ausgangsituation nutzen. Dafür ist zunächst in Rechnung zu stellen, wie sich dieses Verhältnis weiter verkompliziert. Eine wesentliche Pointe der Normativität besteht nämlich darin, die Wirklichkeit nicht als solche schlicht zu akzeptieren, sondern umgekehrt eben diese Akzeptanz zu verweigern. „Umso schlimmer für die Tatsachen“ ist das Motto jener normativen Sicht, die im soziologischen Jargon als „kontrafaktische Erwartungshaltung“ bezeichnet wird, weil sie sich hartnäckig weigert, von den Tatsachen eines Besseren belehrt zu werden. Dass, um ein altes, in jüngerer Zeit wieder stärker in den Fokus der Diskussion gerücktes Beispiel zu verwenden, de iure der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland grundsätzlich, das heißt von einigen engen Ausnahmen abgesehen, nicht rechtmäßig ist, also von der Rechtsordnung als prinzipiell ungewollt markiert wird, wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass de facto in jedem Jahr eine knapp sechsstellige Zahl entsprechender Maßnahmen durchgeführt wird. Die normative Aussage bleibt von der entgegenstehenden tatsächlichen Praxis prinzipiell unberührt. Sie hält trotzig fest an ihrer eigenen Vorstellung einer Wirklichkeit, die sich von der „wirklichen Wirklichkeit“ nicht beeinflussen lässt.
IV.
Entscheidend für das Verständnis der Peinlichkeit der Situation ist aber etwas Drittes. Die am Anfang erzählte Geschichte zeigt gerade auch, dass die scharfe Gegenüberstellung von Wahrheit und Normativität fehlgeht. Die in der Eingangsszene hervortretende Differenz von wahr und falsch lässt sich vielmehr noch einmal anders rekonfigurieren und buchstäblich komplizierter, das heißt die beiden scheinbar getrennten Seiten in- und übereinander faltend, darstellen. Deutlich wird das schon daran, dass die Inszenierung auf der Bühne selbst das Problem des sozialen Miteinander thematisieren kann. Entsprechendes gilt für unsere Vorstellung – im doppelten Sinn des Worts – von der Verfaltung zwischen dem Geschehen auf der Bühne und der Aktion im Zuschauerraum. In beiden Fällen geht es nicht um bloße Nachahmung, also die per definitionem defizitäre Repräsentation der eigentlichen, wirklichen Wirklichkeit. Es geht ebenso darum, eine Wirklichkeit eigenen Rechts zu erschaffen, die an der „wirklichen Wirklichkeit“ – in Gestalt von Alexandra Kowalski – keinen Prüfmaßstab ihrer Gültigkeit mehr besitzt. Das Geschehen auf der Theaterbühne ist nicht nur und erst in dem Maße legitim, in dem es als Mimesis der realen Wirklichkeit erscheint.
Natürlich kann ein Stück eine entsprechende Engführung versuchen und selbst unmittelbar auf die gegenwärtige, namentlich politische Realität Bezug nehmen und sich an ihr messen. Es kann aber ebenso gut diese Wirklichkeit als Bezugsgröße ignorieren und einer eigenen Wirklichkeitskonstruktion vertrauen, die sich nicht erst durch Anknüpfung an die „wirkliche Wirklichkeit“ rechtfertigt. Wer diese Möglichkeit verkennt, verkennt zugleich die Vielfalt der mit der „wirklichen Wirklichkeit“ gegebenen alternativen Wirklichkeiten, die sich nicht einfach im Sinne eines Vulgärplatonismus als „bloßer Schein“ zurückweisen lassen, weil sie ihrerseits ganz konkrete soziale Phänomene mit sowohl expliziten eigenständigen Regeln als auch impliziten habitualisierten Verhaltensmustern hervorbringen. Eine der Komplexität der Phänomene gegenüber angemessene Ontologie des Sozialen lässt sich nicht auf eine Lehre von dem, was ist, begrenzen. Sie muss ebenso sehr darauf achten, was sich und wie sich etwas darstellt und in dieser Darstellung seine eigene Existenz hervorbringt. Was sich in dieser Hinsicht im Theater manifestiert, gilt mutatis mutandis auch für alle anderen Formen sozialer Kommunikation, die nicht einfach sind, sondern sind, indem sie sich präsentieren, und die dadurch, statt die scheinbar scharfe Trennlinie von Fiktion und Realität bloß aufzuheben, diese immer wieder kreuzen. Die mise-en-scène des Rechts ist dafür nur ein weiteres Beispiel. (Das gilt für die Rechtspraxis ebenso wie für die Rechtswissenschaft. Denn auch diese zeichnet aus, dass sie selbst in ihren abstrakten theoretischen Erörterungen die Selbstbeschreibung und -darstellung des Rechts ernst nimmt, also nicht als ein bloßes Scheinphänomen versteht, das mit Verweis auf alternative, allgemein-kausalwissenschaftliche Erklärungsmuster zu beseitigen wäre. Rechtswissenschaft ist eher Theologie als Religionswissenschaft; sie gibt den internen Grundannahmen ihres Untersuchungsgebiets Kredit. In diesem Sinn ist sie stets dogmatisch.)
Eine Sichtweise, der es nicht gelingt, die spezielle Struktur dieser sozialen Operationen zu erkennen, die stattdessen die Vielfalt gesellschaftlicher Wirklichkeiten auf die eine wahre Wirklichkeit reduziert, entspricht dem Verhalten jenes Mannes im Zuschauerraum, der ausschließlich die Existenz von Alexandra Kowalski anerkennt und deswegen diejenige von Maria Stuart bestreiten muss. (Eine solche Sichtweise bleibt deswegen natürlich möglich; sie für sich genommen keineswegs falsch – im Gegenteil. Wer sich in die Position eines von außen an das Geschehen herantretenden Beobachters versetzt, sieht etwas Wesentliches und in dieser und für diese Perspektive Wahres. Er sieht aber zugleich etwas Anderes nicht: Eine angemessene Wahrnehmung des Schauspiels als solchem wird durch den externen Standpunkt versperrt; sie setzt voraus, dass man sich auf dessen Eigenlogik einlässt. In der Rechtswissenschaft wird diese Differenz teilweise unter den Stichwörtern von der Teilnehmer- vs. der bloßen Beobachterperspektive verhandelt. Diese Unterscheidung darf nicht als Gegensatz von Theorie und Praxis missverstanden werden: Auch und gerade die Rechtstheorie macht die Grundannahme mit, dass das Recht ein selbständiges Gebiet ist, das einer spezifischen Eigenlogik folgt. Die Theorie kann diese Annahmen noch einmal reflektieren und versuchen, ihre Notwendigkeit zu erklären und auf sich zugleich ereignende Verfaltungen mit anderen Bereichen des Sozialen verweisen. Sie kann als Rechtstheorie diese Annahme aber nicht einfach aufheben.)
V.
Für die Frage nach dem Verhältnis von Empirismus und Normativität hat die Ausgangsgeschichte eine einfache Konsequenz. Es ist demnach ganz richtig, dass es zu wenig Empirie im Recht und in der Rechtswissenschaft gibt. Aber der spezielle Charakter dieses „zu wenig“ muss genauer bestimmt werden. Das Verständnis der Empirie greift zu kurz, wenn es Empirie stets ausschließlich in den Singular setzt und nicht vielmehr in Rechnung stellt, dass es eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Formen von Wirklichkeit und somit auch von Empirie gibt. Der Empirismus ist selbst zu pluralisieren; er muss in das eigene Verfahren die Einsicht integrieren, dass die durch Erfahrung gegebene Wirklichkeit nicht nur in einer einzigen Gestalt erscheint.
Eine sich auf diese Situation einstellende Epistemologie hat dementsprechend anzuerkennen, dass es auch sie selbst lediglich als Geflecht vielfältiger Epistemologien geben kann. Statt den Empirismus als gewandelte Gestalt gewissheitsverbürgender Transzendentalphilosophie misszuverstehen, ist er als anti- oder genauer vielleicht, da nicht in schlichter Opposition verharrend: quasi-transzendentales Versprechen beim Wort zu nehmen und damit gegen das metaphysische Begehren nach absoluter Gewissheit zu wenden. In der so verstandenen empirischen Erfahrung zeigt sich, wie jeder empeiria je schon eine aporia eingeschrieben ist.