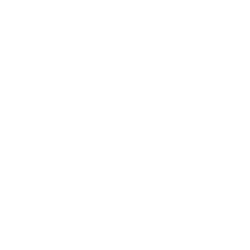Deutsche Juristen mögen lateinische Redewendungen – besonders wenn sie ihnen das Leben erleichtern. Eine dieser Redewendungen lautet iudex non calculat: „Der Richter rechnet nicht.“ Sie bedeutet, dass Rechenfehler im Urteil auch nachträglich berichtigt werden dürfen, obwohl Gerichtsurteile nach einer gewissen Zeit rechtskräftig werden. So war es schon bei den alten Römern, und so will es heute Paragraph 319 Absatz 1 der deutschen Zivilprozessordnung. Diese Verfahrensvorschrift ist allerdings selten gemeint, wenn Juristen „Iudex non calculat!“ sagen. Stattdessen behaupten sie damit – oft im Scherz, manchmal aber auch ganz ernsthaft – dass von ihnen keine mathematischen Interessen oder Fähigkeiten erwartet werden dürfen. Dieses behagliche Selbstverständnis gerät neuerdings durch die empirische Rechtsforschung ins Wanken.
Realitäten systematisieren: Die Rechtstatsachenforschung
„Neuerdings“, das ist in den Rechtswissenschaften ein dehnbarer Begriff. Blickt man auf die 1.800 Jahre seit Aemilius Macer die „iudex non calculat“-Regel formulierte, so sind auch die letzten hundert Jahre noch „neuerdings“. Und etwa so lange ist es her, dass der Anwalt Arthur Nussbaum eine Streitschrift veröffentlichte, deren Nachbeben wir noch heute spüren: „Man ist der leeren Dogmatik überdrüssig geworden“, schrieb er 1914 und sagte zugleich,
„worauf es ankommt: nämlich die systematische wissenschaftliche Verarbeitung … derjenigen Tatsachen, deren Kenntnis für ein volles Verständnis und eine sachgemäße Anwendung der Normen erforderlich ist“.1
Nussbaum forderte Juristen damit auf, sich um systematische (das heißt statistische) Tatsachenkenntnis zu bemühen, und zwar ausdrücklich ohne ihre tradierte Begriffsarbeit aufzugeben. Rechtsempirie sollte Rechtsdogmatik ergänzen, also Sein und Sollen verbinden, ohne die juristischen Methoden gleich durch sozialwissenschaftliche zu ersetzen – wofür einige Zeitgenossen Nussbaums plädiert hatten. Nach Nussbaum sollten es Juristen als ihre ureigene Aufgabe begreifen, Rechtstatsachen zu ermitteln und zu dokumentieren und in die Analyse von Rechtsfragen systematisch einzubeziehen. Der Richter sollte rechnen lernen.
Entscheidungen strukturieren: Die Normbereichsanalyse
Nussbaum schrieb dies vor dem Ersten Weltkrieg, in der goldenen Zeit des sogenannten Wissenschaftspositivismus, als quer durch alle Disziplinen eine Fortschrittseuphorie darüber herrschte, „die Realität“ zu erkennen, zu verstehen und zu vermessen. Wie „vermessen“ diese Erkenntniseuphorie war, wurde erst später wirklich deutlich, als neue wissenschaftliche Paradigmen – Quantenphysik, Komplexitätsforschung, Sozialpsychologie, Systemtheorie, philosophische Hermeneutik, Gehirnforschung und Bayes-Statistik – in verschiedensten Variationen auf die immer gleiche Schlussfolgerung hinausliefen: Beobachtung und Beobachter lassen sich nicht trennen, die Welt hat keinen auktorialen (objektiv-allwissenden) Erzähler. Aus „der Realität“ wurden plötzlich mannigfaltige „Realitäten“, aus der Methodik des Erkennens jene des Begründens, Rationalität bedeutete nicht mehr eine logische Ableitung aus „objektiven“ Gegebenheiten, sondern die argumentative Bewältigung vielfältiger politischer und sozialer Wertdiskurse.
Was bedeutet diese neue Diskursrationalität für die Realitäten des Rechts? Das derzeit wohl umfangreichste juristische Methodenlehrbuch (in zwei Bänden) sagt dazu, nur eine „systematisch ansetzende Methodik“ könne die Erkenntnisse empirischer Forschung „mit den Elementen der Normtextauslegung rational … in Beziehung“ bringen; diese „Normbereichsanalyse“ sei kein intellektuelles Glasperlenspiel, sondern ein ganz „wesentlicher Faktor juristischer Entscheidung“.2 Denn auch empirische Erkenntnisse sind weniger Tatsachenfeststellungen als -festsetzungen, also wertgebundene Weltbeschreibungen. Ihre statistische Argumentform darf nicht über den rhetorisch-diskursiven Charakter der Empiriegewinnung hinwegtäuschen. Daher bedarf die Rechtswissenschaft einer „Erkenntnistheorie, die speziell auf das juristische Feld und seine eigenartigen Zwecksetzungen und Problemstellungen zugeschnitten ist“.3
Entscheidungsrealitäten vermitteln: Evidenzbasierte Jurisprudenz
Betrachtet man diese „Zwecksetzungen und Problemstellungen“ näher, so tritt eine eigenartige Parallele hervor: Juristen behandeln überwiegend pathologische Problemfälle, in denen es zwar auf übergreifendes Erfahrungswissen ankommt, aber im Kontext eines praktischen Einzelfalles. Der bedarf stets einer möglichst schnellen Entscheidung, geht aber zugleich in das Erfahrungswissen der Disziplin ein, sodass er mittelbar auch alle weiteren ähnlich gelagerten Fälle beeinflusst. Diese Symptome kennen wir aus einem anderen Bereich – der Medizin. Auch Ärzte behandeln akute pathologische Einzelfälle und benötigen schnell verfügbares und dabei möglichst zuverlässiges Entscheidungswissen. Das erhalten sie durch die sogenannte Evidenzbasierung, ein Verfahren zur effizienten Sichtung und kritischen Beurteilung einschlägiger empirischer Vorarbeiten. Dieses Erkenntnisverfahren könnte wertvolle Impulse für die Rechtswissenschaft liefern.
Juristische Evidenzbasierung in diesem Sinne vollzieht sich in vier Schritten: Aus der juristischen Frage sind die (oft unausgesprochenen) empirischen Vorfragen herauszuarbeiten, die frühere Forschung hierzu aufzufinden, sie methodenkritisch zu würdigen (wobei bestimmte Forschungsmethoden höhere Wertschätzung genießen als andere) und anhand dieser expliziten Bewertung die Rechtsfrage zu beantworten.4 Das bedeutet also, dass Evidenzbasierung weder die argumentative Autonomie noch die Erfahrungssättigung des Rechts entbehren oder ersetzen kann. Deshalb beschrieb der Schweizer Rechtsphilosoph Philippe Mastronardi vor einigen Jahren das „Juristische Denken“ wie folgt:
„Rechtswissenschaft ist zwar eine normative Wissenschaft. Aber nicht nur: sie muss auch die soziale Wirklichkeit erkennen. Sie ist damit Geisteswissenschaft und Sozialwissenschaft in einem, ein Verfahren der gegenseitigen Übersetzung zwischen Norm und Faktum. … Rechtswissenschaft muss daher zugleich Seinswissenschaft und Normwissenschaft sein.“ 5
Evidenzbasierung begegnet den traditionellen dogmatischen Methoden also gewissermaßen dialektisch, indem sie eine dogmatische These mit empirischen Antithesen konfrontiert und zur evidenzbasierten Synthese vereinigt. Aus dem rechtlichen „Sollen“ allein ließe sich ohne konkrete Vorstellung vom „Sein“ ja noch keine Handlungsempfehlung ableiten: Der syllogistische Schluss vom Sollen-im-Prinzip auf das Sollen-im-Konkreten erfordert einen Untersatz, der empirisch gehaltvoll sein muss. Denn er überführt einen apriorisch-rechtsethischen Obersatz (Sollen-im-Prinzip) in eine pragmatisch-handlungsleitende Schlussfolgerung (Sollen-im-Konkreten). Erkenntnisse über das Sein schlagen folglich die Brücke zwischen Sollen und Sollen: Der ohne Empirie versuchte Sprung vom Rechtsprinzip zur Handlungsempfehlung enthielte ebenso einen „logischen Fehlschluss“ wie die Ableitung eines Sollens direkt aus dem Sein.6
Die juristische Zukunft: Mit Rechts|Empirie ist zu rechnen.
Die evidenzbasierte Methodik zeigt, dass die Rede vom Richter, der nicht rechnet, zu radikal ansetzt. Juristen dürfen und müssen empirische (also auch statistische) Argumente zwar hinterfragen, aber nur durch ernst- und gewissenhafte Methodenkritik, nicht durch gewohnheitsmäßige Vermeidung. Statistik ist Rhetorik;7 erst eine disziplinierte argumentative Auseinandersetzung mit („der“) Empirie ergibt den Wert der dadurch gewonnenen Erkenntnisse für sozialpolitische Diskurse wie denjenigen des Rechts:
Die Perspektive rechtswissenschaftlicher Forschung kann demnach sinnvollerweise nur darin liegen, empirische und hermeneutisch fundierte Zugänge zu akzeptieren, um eine umfassendere Erkenntnis über das Recht und seine Wirkungen zu erlangen.8
Auch der Bundesgerichtshof betont seit mindestens 35 Jahren immer wieder, dass Richter die „Gutachten gerichtlicher Sachverständiger sorgfältig und kritisch zu würdigen“ haben – doch das geht nur mit Grundkenntnissen von Statistik und Empirie. Noch sind Juristen dafür durch ihre Ausbildung schlecht gewappnet,9 deshalb „drängt die Zeit“, durch „Vermittlung von Grundkenntnissen der Statistik“ zu „einer zukunftsfähigen Juristenausbildung“ vorzudringen.10
Das mit dem vorliegenden Beitrag eröffnete Wissenschaftsblog Rechts|Empirie (Legal Empirics in Europe) will diese Entwicklung begleiten, durch anschauliche Arbeitsskizzen aus den Werkstätten rechtsempirischer Forscher zum Verständnis ihrer Methoden beitragen und dadurch einen niederschwelligen Zugang zu aktuellen rechtsempirischen Methodendiskursen eröffnen. Dadurch sollen auch Juristen, die sich in der sozialwissenschaftlichen Primärliteratur nicht zu Hause fühlen, die wesentlichen Entwicklungen der europäischen Rechtsempirie nachvollziehen können. Das Blog wird Beiträge in verschiedenen Sprachen akzeptieren, aber Beiträgen in anderen Sprachen als Englisch einen englischen Abstract beifügen. Alle Beiträge sollen knapp, anschaulich und für statistische Novizen verständlich sein. Denn je komplexer die Wirklichkeiten des Rechts, desto wichtiger wird zumindest das statistische Grundverständnis. Schon deshalb gehört die „Zukunft der rationalen Rechtswissenschaft“ neuerdings den „Herren der Statistik“. Doch das schrieb einer der berühmtesten US-amerikanischen Richter schon um die vorletzte Jahrhundertwende,11 insofern entsetzt es uns heute vielleicht nicht mehr allzusehr.
Der Autor ist einer von drei Gründungsherausgebern des Blogs Rechts|Empirie, sein Blogbeitrag beruht weitgehend auf einem Forschungsbericht im Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft und einem Aufsatz im Archiv für die civilistische Praxis (AcP).
- Nussbaum, Die Rechtstatsachenforschung. Ihre Bedeutung für Wissenschaft und Unterricht, Tübingen 1914, S. 1, 3, 6.
- Müller/Christensen, Juristische Methodik Bd. 1: Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, Berlin 11. Aufl. 2013, S. 527–528.
- Augsberg, Rechtswirklichkeiten, in denen wir leben. New Legal Realism und die Notwendigkeit einer juristischen Epistemologie, Rechtstheorie 46, (2015), 71, 88.
- Hamann, Evidenzbasierte Jurisprudenz. Methoden empirischer Forschung und ihr Erkenntniswert für das Recht am Beispiel des Gesellschaftsrechts, Tübingen 2014; beispielhaft vorgeführt in Hamann/Hoeft, Die empirische Herangehensweise im Zivilrecht. Lebensnähe und Methodenehrlichkeit für die juristische Analytik?, AcP 217 (2017), 311, 317–328.
- Mastronardi, Juristisches Denken. Eine Einführung, Stuttgart 2. Aufl. 2003, Rn. 246.
- Chang/Wang, The Empirical Foundation of Normative Arguments in Legal Reasoning, SSRN 2016, 5: “without an empirical premise that performing a certain action will achieve a given goal or value, it is also a logical fallacy to jump from the goal or value to a normative claim that this action ought to be done”.
- Abelson, Statistics As Principled Argument, Hillsdale 1995 (Nachdruck 2009).
- Kuntz, Auf der Suche nach einem Proprium der Rechtswissenschaft, AcP 219 (2019), 254, 298
- Bestandsaufnahme in Hamann, Empirische Erkenntnisse in juristischen Ausbildungsarbeiten: Prüfungsschema, Zitier- und Arbeitshilfen für das Jurastudium und danach, JURA – Juristische Ausbildung 39 (2017), 759–769
- Altwicker, Von Rechtsnormen zu Rechtsdaten (und zurück) – Warum Jusstudierende heute Statistikgrundkenntnisse brauchen, recht 36 (2018), 62; Dyevre, The Future of Legal Theory and the Law School of the Future, Antwerpen 2015, passim.
- Holmes, The Path of the Law, Harvard Law Review 10 (1897), 457, 469.